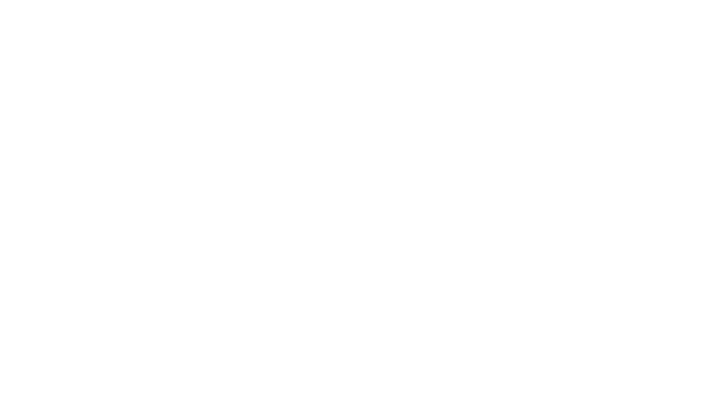Im fünften Schuljahr ist Sabine Schorpp am Institut für Soziale Berufe (IfSB): nicht als Schülerin, sondern als Lehrkraft für Psychologie und Psychiatrie für Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz. Die Kultur des Erinnerns ist aufgrund des historischen unmenschlichen Umgangs mit Menschen mit Behinderungen in Deutschland in ihrem Unterricht immer wieder Thema.
Sabine Schorpp spricht lieber in der Mehrzahl: von Erinnerungskulturen. Immerhin stammt ein Großteil der Schülerinnen und Schüler am IfSB aus anderen Ländern. Was geschichtlich für Deutschstämmige von Bedeutung ist, kennen sie womöglich nicht oder kaum. Dafür bringen sie aus ihren Heimatländern eigene Themen mit. Die heißen zum Beispiel Kolonialismus, Apartheit oder Genozid. Andersherum kennt man hierzulande jene Geschichte womöglich auch nur wenig. Über Vergehen aus der Vergangenheit zu sprechen, bedeutet immer auch sensible Themen aufzugreifen, bei denen Traumata und Leiden hervortreten können. Behutsamkeit ist gefragt.
Neue Erkenntnisse oft überraschend
Aus der Zeit des Nationalsozialismus ist zwar jedem die mehr als sechsmillionenfache Ermordung der jüdischen Bevölkerung bekannt. Die systematische Tötung der 70 000 Menschen mit körperlichen, psychischen oder kognitiven Behinderungen im Rahmen der sogenannten T4-Aktion ist vielen wenig geläufig. Im Unterricht der klinischen Psychologin geht es unter anderem um Entwicklungspsychologie, Emotionsregulierung und auch um Krankheitsbilder und Formen von Behinderungen. Unweigerlich wird der Massenmord durch die Nazis zum Thema. Dann herrscht neben großem Interesse oft Ungläubigkeit, Empörung und Entsetzen. „Junge Menschen wissen das oft gar nicht, sie können es sich nicht gut vorstellen“, schildert Sabine Schorpp. Dass es sich um solche Menschen handelte, die sie in der Ausbildung und später als Fachkräfte begleiten, macht die Betroffenheit nicht geringer.
Greifbare Orte machen betroffen
Besonders berührt seien die Azubis der Fachschule für Heilerziehungspflege bei Exkursionen im Rahmen von „Sinn-Tagen“: zur Gedenkstätte in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb, wo mehr als 10000 Menschen mit Einschränkungen systematisch ermordet wurden, oder in den Goldbacher Stollen bei Überlingen, wo Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen schufteten und viele von ihnen starben. Die Schülerinnen und Schüler können auch eine direkte Verbindung zu den Vergehen herstellen, weil die Betroffenen aus den Einrichtungen in der Region abtransportiert wurden, in denen sie heute ihre Ausbildung machen. Für sich als Pädagogin sieht sie eine Hauptaufgabe, traumatische Themen didaktisch so zu verpacken, dass Schülerinnen und Schüler einen Zugang finden. Sie ist überzeugt: Der Blick zurück ist wichtig, ist aber nur zielführend, wenn Erkenntnisse für die Zukunft genutzt werden. Dabei gilt auch zu berücksichtigen: „Wie erinnern wir an eine Geschichte, die nicht die Geschichte von uns allen ist.“
Zeitgemäße Formen der Erinnerungskulturen
Die Zeitzeugen, die die Nazizeit er- und überlebt haben, werden immer weniger und mit ihnen versiegt auch die Quelle der direkten Geschichtserzählung. Die 30-Jährige plädiert daher für moderne Formen der Erinnerungskultur. Auch wenn es für ältere Menschen befremdlich sein mag, finden junge Menschen womöglich über Live-Clips in den sozialen Medien zu dem Thema Zugang, möglicherweise entstanden in einem Vernichtungslager wie Auschwitz. Erinnerungskultur braucht also auch Toleranz zwischen den Generationen. Die Psychologin nennt ein anderes interessantes Beispiel des Gedenkens. Nämlich die Rückgabe von persönlichen Gegenständen von KZ-Häftlingen an Angehörige oder an deren Nachfahren. Seit 1963 befinden sich bei den „Arolsen Archives“ Schmuckstücke, Erinnerungsfotos oder Briefe. Unter #StolenMemory können Interessierte helfen, die Angehörigen zu finden. „Wir müssen die digitale Kompetenz der jungen Generation nutzen“, unterstreicht die Psychologin in diesem Zusammenhang.
Ausbildung ja, Wohnung nein
Betroffen mache die jungen Menschen aber auch die Tatsache, wie schnell der Prozess der Ausgrenzung und Diskriminierung gesellschaftlich fortschreiten kann. Zumal sie durch ihre eigene Hautfarbe, Herkunft und Sprache selbst betroffen sein können und nicht selten sind. Den verborgenen und offene Alltagsrassismus kennen viele von ihnen, egal ob individuell oder strukturell. Beispiel Wohnungssuche: Nach der Ausbildung müssen Azubis in der Regel aus den für sie bereitgestellten Wohnheimen ausziehen. Auf Grund ihres Namens oder der Hautfarbe finden Menschen mit Migrationshintergrund im ländlichen Raum oft keine Wohnung. In der Folge muss nicht selten ein schon unterschriebener Arbeitsvertrag wieder aufgelöst werden. Die Fachkräfte wandern in die anonymeren Städte ab.
Psychiatrische Erkrankungen
Sabine Schorpp ist mit Leib und Seele klinische Psychologin. Studiert hat sie an der Uni in Konstanz. Ihre Motivation, das Fach zu studieren, hüllt sie in einen einfachen Satz: „Ich wollte die Menschen besser verstehen.“ Ihr spannender Beruf sei thematisch breit aufgestellt mit vielen Feldern und Aspekten. Auch das rationale, wissenschaftliche Vorgehen und das „Bohren in den Tiefen“ findet sie spannend. „In Bezug auf ‚Mensch‘ hat jeder eine Idee, wie und warum Menschen so sind, wie sie sind.“ An der Psychologie findet sie daher interessant, dass sie Nachweise erbringt. Häufig sei sie selbst darüber verwundert, wie Menschen sein können, was sie aushalten können, wie wenig oder wie viel es manchmal braucht, dass sie an der Seele krank werden. Und faszinierend findet sie, wie unterschiedlich das Gehirn funktioniert. In der Tat ein weites Feld für eine junge Lehrkraft.
Anne Oschwald