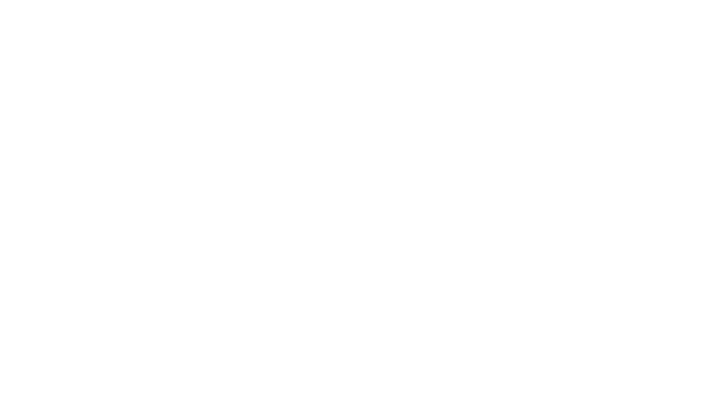Geschichte macht das Heute bedeutsam
Vergeht die Vergangenheit, oder vergeht sie nicht? Ist die Vergangenheit ein abgeschlossenes Kapitel? Je nach wissenschaftlicher Perspektive variieren die Antworten auf diese Fragen. Erinnerungskultur betont, dass auch erforschte Geschichte in Vergessenheit gerät, wenn sie nicht im Bewusstsein bleibt und kein lebendiger Bezug zur jeweiligen Gegenwart besteht. Nach dem Kulturwissenschaftler Jan Assmann wird mit der Erinnerungskultur an die eigene soziale Gruppe die Frage „Was dürfen wir nicht vergessen?“ gestellt und beantwortet. Erinnerungskultur bewahrt das kollektive Gedächtnis und fördert die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Sie ermöglicht es den Menschen, historische Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Gegenwart zu reflektieren. Geschichte bleibt so bedeutsam, weil sie das Selbstbild einer Gesellschaft prägt und gemeinschaftsstiftend wirkt.
Ausgangspunkte der Kultur des Erinnerns
Die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus bleiben Kern und Ausgangspunkt der Erinnerungskultur in Deutschland: Der Holocaust, die systematische Ermordung von Sinti und Roma und von Menschen mit Behinderungen, die Stigmatisierung und Entrechtung der wegen ihrer sexuellen Orientierung und ihrer religiösen und politischen Überzeugungen verfolgten Menschen dürfen nicht vergessen werden. Seit 1990 ist ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur des wiedervereinten Deutschlands auch die Auseinandersetzung mit dem SED-Unrecht und der kommunistischen Diktatur in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR.
Vielfältige Gesellschaft braucht das Erinnern
Heute prägen viel mehr Menschen mit migrantischem Familienhintergrund die deutsche Gesellschaft und erheben zu Recht Anspruch darauf, mit ihren Erinnerungen und Erfahrungen wahrgenommen zu werden. In einer modernen Einwanderungsgesellschaft wird Erinnerungspolitik auch durch die Erfahrungen von Migrant:innen geprägt. Viele von ihnen haben in ihrer Heimat, auf ihrer Flucht oder hier in Deutschland traumatische Erlebnisse gemacht – sei es durch Krieg, Verfolgung oder Ausgrenzung.
In vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland, verschiebt sich das politische Gewicht derzeit nach rechts. Damit verbunden ist der Anstieg von Hass gegen Migrant:innen, Frauen und queere Menschen und einer wachsenden Abwertung des Holocaust-Gedenkens. Dabei haben die Überlebenden des Holocaust und Zeitzeugen der NS-Diktatur uns Nachgeborenen eine klare Aufgabe mitgegeben: uns für Menschenrechte, Gleichheit und Freiheit einzusetzen.
Berufe mit belasteter Vergangenheit
Gerade am Institut für Soziale Berufe, an dem angehende Pflegefachkräfte, Heilerziehungspfleger:innen, Heilpädagog:innen und Erzieher:innen ausgebildet werden, muss Erinnerungskultur eine zentrale Rolle spielen. Viele dieser Berufe haben eine belastete Vergangenheit: Während der NS-Zeit waren Berufsgruppen aus Medizin, Pädagogik und Fürsorge direkt oder indirekt in systematisches Unrecht verwickelt – etwa im Rahmen der sogenannten „Euthanasie“-Verbrechen oder bei der Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen oder anderen als „abweichend“ markierten Lebensweisen. Ein kritischer Blick auf diese Geschichte hilft, ein berufliches Selbstverständnis zu entwickeln, das auf Menschenrechten, Empathie und Verantwortung gründet.
Vielfältige Chancen nutzen
Gleichzeitig lernen an unserer Einrichtung Auszubildende aus vielen verschiedenen Herkunftsländern, Kulturen und Religionen miteinander. Viele bringen eigene Erfahrungen wie Krieg und Flucht, oft aber auch familiär überlieferte Diskriminierung durch Kolonialismus und Rassismus mit. In dieser Vielfalt liegt eine große Chance: Eine gemeinsame Erinnerungskultur kann ein Ort sein, an dem unterschiedliche Erfahrungen wertgeschätzt, miteinander geteilt und in Beziehung gesetzt werden. Konkret bedeutet dies:
- Gemeinsames Lernen aus der Geschichte: Die Auseinandersetzung mit historischen Verbrechen – ob in Deutschland oder weltweit – schärft das Bewusstsein für heutige Formen von Diskriminierung, Machtmissbrauch und Ausgrenzung.
- Förderung von Empathie und Perspektivwechsel: Wenn verschiedene Biografien und Sichtweisen in den Dialog treten, kann ein tieferes Verständnis füreinander entstehen – auch jenseits kultureller oder religiöser Unterschiede.
- Stärkung der beruflichen Haltung: Für soziale Berufe ist es entscheidend, achtsam, reflektiert und menschenrechtsorientiert zu handeln. Erinnerungskultur fördert diese Haltungen auf einer ethischen und emotionalen Ebene.
- Identitätsbildung in der Vielfalt: Gerade in einem diversen Lernumfeld kann eine geteilte Auseinandersetzung mit Geschichte helfen, ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln – nicht trotz, sondern gerade wegen der Verschiedenheit. Erinnerungskultur wird so zu einem verbindenden Element, das Zugehörigkeit ermöglicht, ohne Unterschiede zu überdecken.
Basis eines zukunftsorientierten Lernprozesses
So verstanden ist Erinnerungskultur weit mehr als nur Rückblick: Sie wird zu einem aktiven, zukunftsgerichteten Lernprozess – einem Mittel zur Persönlichkeitsbildung, zur Förderung sozialer Kompetenzen und zur Stärkung demokratischer Werte im Berufsalltag. Sie kann helfen, aus Vielfalt eine echte Gemeinschaft zu formen – sensibel, verantwortungsvoll und solidarisch. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann sich somit zu einer bedeutsamen und bislang wenig genutzten Ressource entwickeln. In einer Welt, die von sozialer Spaltung, politischer Polarisierung und einer aufgeheizten Gesellschaft geprägt ist, eröffnet sie wertvolle Perspektiven für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft.
Erinnerung erfahrbar machen
In der Ausbildung braucht es eigene Methoden, um Erinnerung von der abstrakten auf die spürbare Ebene zu übertragen. Besonders wirkungsvoll sind projektorientierte und künstlerische Ansätze, da sie individuelle Erfahrungen mit historischen Themen verbinden, Kreativität fördern und gemeinsames Arbeiten ermöglichen – auch über Sprachbarrieren hinweg. Projektarbeiten ermöglichen wiederum, sich aktiv etwa mit Recherchen zu regionalen Biografien aus der NS-Zeit, Besuchen von Gedenkstätten, Interviews mit Zeitzeug:innen oder die Arbeit mit historischen Quellen auseinanderzusetzen. Durch die Verbindung mit der lokalen Geschichte, etwa in Oberschwaben oder direkt in Ravensburg, entsteht eine persönliche Nähe zum Thema, die nachhaltiges Lernen fördert.
Künstlerische Methoden wie Theater, Fotografie, Collagen, Poetry-Slams, biografisches Schreiben oder Installationen ermöglichen es, sich auch auf emotionaler Ebene mit Vergangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. Gerade in Gruppen mit sprachlicher oder kultureller Vielfalt schaffen kreative Ausdrucksformen neue Möglichkeiten des Verstehens und des Dialogs.
Historisches Bewusstsein stärkt soziale Kompetenzen
Solche Ansätze stärken nicht nur historisches Bewusstsein, sondern auch Kompetenzen, die in sozialen Berufen zentral sind: zuhören, Verantwortung übernehmen, Perspektivwechsel üben. Darüber hinaus fördern sie Selbstwirksamkeit und Teilhabe, da alle Beteiligten eigene Zugänge finden und aktiv zur Gestaltung beitragen können. Langfristig kann so eine gelebte Erinnerungskultur entstehen, die nicht von außen „vermittelt“ wird, sondern im gemeinsamen Tun wächst – offen, vielfältig und zukunftsorientiert.
Heidi Fischer
Literatur:
Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. 2. Auflage. C. H. Beck, München 1997
Aleida Assmann: Vergangenheit, die nicht vergeht. Gespaltene Gesellschaften und gegensätzliche Narrative. Picus-Verlag, Wien 2023