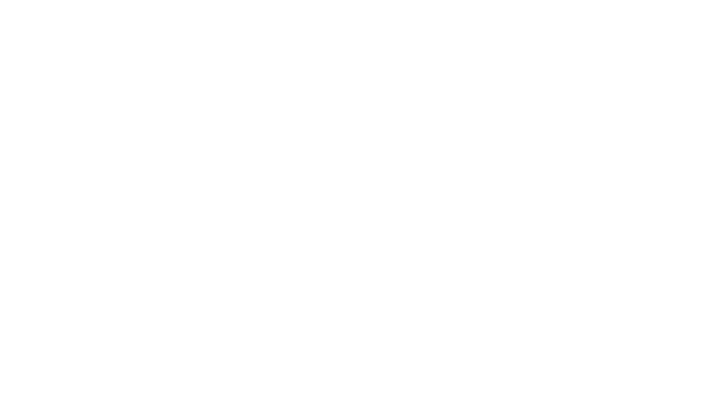Gesellschaftliche Veränderungen, die fortschreitende Digitalisierung oder die zunehmende Interkulturalität nehmen in hohem Maße Einfluss auf die Anforderungen, die der Beruf und der Alltag an jede einzelne pädagogische Fachkraft stellt. Wissen und Fähigkeiten des Lernens in der Schule und der Berufsausbildung reichen heute nicht mehr aus, um eine mehrere Jahrzehnte dauernde Berufslaufbahn zu bewältigen und aktiv an der Gesellschaft zu partizipieren.
Die Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen ist seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts die Devise „Lifelong learning for all“. Diese gesellschaftliche Aufwertung des lebenslangen Lernens erweist sich für die erwachsenen Lernenden als zweischneidiges Schwert: einerseits als individuelle Chance der Selbstbestimmung, der Horizonterweiterung und der Partizipation, andererseits auch als ständige Anstrengung und Selbstdisziplinierung.
Lehren hat nicht automatisch Lernen zur Folge
Menschen lernen, solange sie leben. Leben ist untrennbar mit Lernen verbunden. Wissen bildet sich jedoch nicht durch Belehrung im Lernenden ab. Es entsteht durch die Einbindung von Informationen in einen Erfahrungskontext und mündet schließlich in der Fähigkeit, effektiv zu handeln. Weiterbildungen integrieren deshalb die Lebenserfahrung, Berufspraxis, wissenschaftliches Wissen und methodische Kompetenzen. Gelingende Bildungsprozesse ermutigen zudem zu einer reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Person, ihren emotionalen Orientierungssystemen und bevorzugten Handlungsmustern.
Lernen vermittelt zwischen dem Menschen und der Welt
Aus pädagogischer Sicht ist Lernen zugleich ein innerer und äußerer Prozess. Lernen vermittelt zwischen Mensch und Umwelt. Dabei lernen Menschen am nachhaltigsten, wenn sie dabei eine aktive und selbstgesteuerte Rolle spielen und das Lernen im Kontext ihrer Lebens- und Arbeitssituation stattfindet.
Ausgangspunkt für Lernprozesse ist stets ein Problem. Daraus folgt der Antrieb, eine Lösung zu finden. Dafür knüpft die jeweilige Person an bereits Erlerntes an und nutzt vertraute Methoden, stellt Hypothesen auf, was zu tun ist, und überprüft diese durch eigenes Ausprobieren. Neues Wissen entsteht. Je öfter und je umfassender dieses neue Wissen konkret angewandt werden kann, desto sicherer und nachhaltiger wird gelernt.
Das Kriterium für den Aufbau unseres Wissens ist nicht das Finden einer objektiven „Wahrheit“. Wissen hat eine pragmatische, eine lebensdienliche Funktion. Es erleichtert die Orientierung, schafft „Ordnung“ in einer unübersichtlichen Welt und ermöglicht so erfolgreiche Handlungen.
Lernen: mehr als Aneignung von Wissen
Das Ergebnis eines Lernprozesses zeigt sich immer im Handeln: Es wird sichtbar in den Entscheidungen und Reaktionen des Individuums in verschiedenen Lebenssituationen. Lernen ist stets eingebettet in emotionale und soziale Situationen. Vor allem in sozialen Berufen geht es darum, wie erworbenes Wissen in konkreten Handlungen umgesetzt wird. Dabei spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Sie sind sowohl Konfliktpotenzial als auch wichtiger Ansatzpunkt für gelingende Entwicklungsprozesse. Es gibt keine rationale Entscheidung, die nicht eingebunden ist in ein individuelles emotionales Muster.
Emotional kompetent handeln
Lernen im Erwachsenenalter kann durchaus riskant und ambivalent sein. Denn das Lernen geht mit der Auseinandersetzung mit biografisch erworbenen Denk- und Handlungsmustern, Einstellungen und Werten einher. Neues zu lernen, bedeutet nämlich auch die alte „Normalität“ und eingespielte Routinen in den Blick zu nehmen und eventuell auch in Frage zu stellen.
In Weiterbildungsprozessen setzen sich die Teilnehmenden deshalb auch damit auseinander, wie Lebens- und Berufserfahrung sich in den Denk-, den emotionalen Verarbeitungs- und den Handlungsmustern niederschlagen. Sie lernen vielfältige Perspektiven zu sehen und das individuelle Handeln auch hinsichtlich der Folgen in den Blick zu nehmen. Die differenzierte Reflexion eigener Persönlichkeitsanteile im beruflichen Handeln ist die Basis für die kontinuierliche Entwicklung der persönlichen Professionalität im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und den anvertrauten Menschen.
Nur das eigene Handeln bringt die Erfahrung
Erfahrungen können nur aktiv handelnd und selbst organisiert gewonnen werden. Zukunftsorientierte Handlungskompetenz hängt entscheidend davon ab, dass der Einzelne sich selbstgesteuert und identitätsstärkend mit den jeweils aktuellen Anforderungen seines beruflichen Handlungsfelds auseinanderzusetzen lernt. Dabei geht es in den Weiterbildungen nicht nur um den Erwerb theoretischen Wissens und angewandter Methoden, sondern darum, dass Lernende ihre Fähigkeiten reflektieren und erweitern. Das gilt im Umgang mit Neuem, der Planung und Gestaltung eigener Lernprojekte sowie dem veränderten Umgang mit vertrauten Sichtweisen und Routinen gleichermaßen. Die Lehrenden unterstützen die Lernenden also dahingehend, dass diese durch den Kompetenzerwerb befähigt sind, sich an ihrem Arbeitsplatz eigenständig mit den spezifischen Belangen und Herausforderungen auseinanderzusetzen und passende Lösungen zu erarbeiten.
Heidi Fischer; Schulleitung Fachschule für Heilpädagogik